Warum es in manchen Sprachen kein Wort für „links“ oder „rechts“ gibt
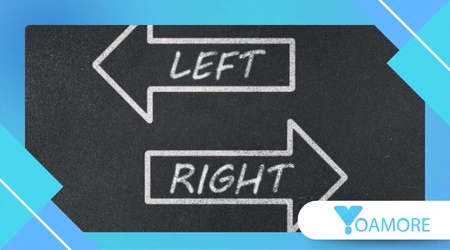
In manchen Sprachen gibt es keine Wort für „links“ oder „rechts“, eine Tatsache, die mehr über das Gehirn und die menschliche Kultur verrät, als wir vielleicht annehmen.
Anzeigen
Weit davon entfernt, eine bloße sprachliche Kuriosität zu sein, bietet diese Abwesenheit einen überzeugenden Einblick in die Art und Weise, wie Menschen Raum konzeptualisieren, mit ihrer Umgebung interagieren und eine kollektive Identität bilden.
Durch eine Kombination aus anthropologischen Beweisen, Kognitionswissenschaft und Beobachtungen aus der realen Welt untersuchen wir, wie diese Richtungslücke die Wahrnehmung verändert.
Dieser Artikel analysiert die kulturellen, neurologischen und funktionellen Auswirkungen dieses Phänomens und bezieht dabei wahre Beispiele, statistische Beweise und Experteneinblicke mit ein.
Sie finden außerdem eine Übersichtstabelle zu globalen Sprachsystemen und zwei vertrauenswürdige externe Ressourcen für eine tiefere Erkundung.
Anzeigen
Eine globale Linse: Nicht alle Sprachen denken gleich
Englisch und die meisten westlichen Sprachen basieren auf egozentrischen räumlichen Begriffen: „links“, „rechts“, „vorne“ und „hinten“.
Diese Richtungen ändern sich je nach Position und Ausrichtung des Sprechers. Dies ist jedoch kein universelles Modell.
In über einem Drittel der bekannten Sprachen der Welt verwenden die Menschen kein Wort für „links“ oder „rechts“ überhaupt.
Stattdessen verwenden sie Himmelsrichtungen (Nord, Süd, Ost, West) oder topografische Hinweise wie bergauf/bergab.
Beispielsweise verwenden die Sprecher des Tzeltal-Maya in Mexiko „bergauf“ und „bergab“, um Orte zu beschreiben, sogar in Innenräumen.
Ebenso beziehen sich die australischen Aborigines Guugu Yimithirr ausschließlich auf die Himmelsrichtungen und sagen Dinge wie „Deine Südseite ist schmutzig“, unabhängig von der Orientierung des Sprechers.
Solche geozentrischen Systeme erfordern ein ständiges Bewusstsein für Landschaft und Richtung, wodurch die Geographie tief in die Wahrnehmung eingebettet wird.
Die Forschung des Kognitionswissenschaftlers Stephen C. Levinson vom Max-Planck-Institut untermauert dies mit belastbaren Daten.
Er stellte fest, dass Personen aus geozentrischen Sprachkulturen bei räumlichen Gedächtnis- und Orientierungsaufgaben oft besser abschneiden als andere, was zeigt, dass diese Richtungssysteme das Gehirn anders trainieren.
Lesen Sie auch: Die Punks von Tijuana: Mikro-Widerstand durch Musik und Stil
Umwelt- und Funktionsnotwendigkeit

Warum lehnen manche Kulturen relative Richtungen ab? Die Antwort liegt im Kontext. In weitläufigen oder topografisch abwechslungsreichen Landschaften ist eine feste Richtungssprache nicht nur präziser, sondern auch überlebenswichtig.
Denken Sie an Gemeinden in offenen Wüsten, Küstenregionen oder Gebirgszügen. In solchen Umgebungen ist es sinnvoller zu sagen: „Gehen Sie nach Osten an den Dünen vorbei“ als zu sagen: „Biegen Sie nach dem Baum links ab.“
Sprecher geozentrischer Sprachen verinnerlichen von frühester Kindheit an die kompassartige Orientierung. Bei ihnen ist nicht der Körper der Bezugspunkt, sondern die Welt.
Dieser Wandel im kognitiven Rahmen beginnt mit der Art und Weise, wie Ältere Anweisungen zum Ablauf von Spielen und Ritualen geben.
Dabei geht es nicht um sprachliche Komplexität, sondern vielmehr um funktionale Anpassung.
Das Land lehrt die Sprache. In urbanisierten, strukturierten Gesellschaften erweisen sich egozentrische Anweisungen jedoch als effizienter.
Gebäude, Raster und Beschilderungen machen relative Positionen zuverlässig und skalierbar. Auf diese Weise reagiert die sprachliche Evolution auf den menschlichen Kontext.
+ Die seltsamsten Grammatikregeln aus aller Welt
Tabelle: Globale Verwendung räumlicher Referenzsysteme
| Raumbezugstyp | Prozentsatz der globalen Sprachen | Primäre Merkmale |
|---|---|---|
| Kardinal (Geozentrisch) | 38% | Verwendet feste Richtungen (N, S, O, W) |
| Relativ (egozentrisch) | 30% | Verwendet die persönliche Körperorientierung (links, rechts) |
| Gemischt/Topografisch | 32% | Verwendet Höhen- und Geländehinweise (bergauf, am Flussufer) |
Laut der Weltatlas der Sprachstrukturen (WALS)Das Kardinalsystem dominiert in den Sprachen, die in Ozeanien, Teilen Afrikas und Mittelamerikas gesprochen werden.
Gehirn und Verhalten: Wie Sprache das Denken prägt
Die Experimente der Kognitionslinguistin Lera Boroditsky mit Sprechern der Aborigines brachten erstaunliche Erkenntnisse zutage: Die Individuen konnten sich selbst in Innenräumen oder in unbekannten Städten mit höchster Präzision orientieren.
Ein Teilnehmer war in der Lage, in völliger Dunkelheit die Himmelsrichtungen genau anzugeben – eine Fähigkeit, die bei Benutzern egozentrischer Sprachen selten anzutreffen ist.
Diese räumliche Intelligenz ist nicht angeboren; sie wird durch den täglichen Gebrauch geozentrischer Begriffe kultiviert. Infolgedessen ist das Fehlen eines Wort für „links“ oder „rechts“ führt zu einem gesteigerten Umweltbewusstsein.
Sprecher müssen immer wissen, wo Norden ist oder wo sich der Berg im Verhältnis zu ihrem Körper befindet.
Sie sind nicht weniger fähig, sondern weisen eine Form von Intelligenz auf, die in unseren metrisch orientierten Gesellschaften unbemerkt bleibt.
Dies deutet darauf hin, dass Sprache nicht nur Gedanken beschreibt, sondern tatsächlich die Fähigkeit des Gehirns, Räume zu verarbeiten, neu verdrahten kann.
+ Die Pirahã-Sprache: Ein Stamm, der keine Wörter für Zahlen hat
Ein Gedankenexperiment: GPS vs. Kompass
Stellen Sie sich das so vor: Die Verwendung relativer Richtungen ist wie die Navigation mit GPS, bei der Ihre Route ständig basierend auf Ihrer Position aktualisiert wird.
Im Gegensatz dazu ist die Verwendung von Kardinalsystemen eher wie das Mitführen eines Kompasses – Sie müssen immer wissen, wo auf der Welt Sie sich befinden.
Beide Systeme funktionieren. Sie lenken Ihre Aufmerksamkeit jedoch unterschiedlich. Ein GPS-Nutzer konzentriert sich auf die unmittelbare Umgebung, während ein Kompass-Nutzer global denkt.
Diese durch die Sprache geprägte mentale Einordnung verändert nicht nur die Art und Weise, wie Menschen Bewegungen, sondern auch Erinnerungen, Geschichtenerzählen und Planen erleben.
Wenn also einer Sprache ein Wort für „links“ oder „rechts“, es ist keine Abwesenheit – es ist eine alternative Weltanschauung.
Gedächtnis, Lernen und langfristige Auswirkungen
Die Art und Weise, wie Kinder diese räumlichen Systeme erwerben, beeinflusst mehr als nur die Richtung.
Studien zeigen, dass Kinder, die mit Kardinalsprachen aufwachsen, bei räumlichen Aufgaben ein besseres Langzeitgedächtnis entwickeln. Warum? Weil sie mentale Karten auf der Grundlage stabiler Bezugspunkte erstellen.
Dieses Modell lässt sich auch auf andere Bereiche übertragen. Beim Geschichtenerzählen beispielsweise beschreiben Sprecher Ereignisse häufig mithilfe von Kardinalbegriffen, um Zeit und Bewegung zu vermitteln.
„Er ging nordwärts in den Sturm“ enthält nicht nur Bilder, sondern auch einen präzisen Ankerpunkt in Raum und Zeit.
Sogar traditionelles Handwerk und Rituale entsprechen dieser Denkweise. In vielen Gesellschaften der amerikanischen Ureinwohner und Aborigines werden Zeremonien und Gebäude nach heiligen Richtungen und nicht nach willkürlicher Platzierung ausgerichtet.
Dies offenbart eine Weltanschauung, in der Orientierung nicht nur praktischer, sondern heiliger Natur ist.
Zwei Fälle aus dem echten Leben, natürlich integriert
Bei den Guugu Yimithirr hört ein Kind vielleicht „Gib das Salz nach Norden von deinem Teller“, statt „nach rechts“.
Dies beeinflusst nicht nur die Grammatik, sondern prägt auch die Wahrnehmung. Ähnlich verhält es sich auf Bali mit Anweisungen wie kaja Und Kelod sind in der Religion verankert und beziehen sich auf Berge und Meer.
Diese Anweisungen strukturieren Häuser, Rituale und sogar tägliche Begrüßungen.
Beide Beispiele beweisen, dass, wenn einer Kultur ein Wort für „links“ oder „rechts“, erhält es einen ganzen Rahmen von Bedeutung und Koordination, der auf etwas Größerem als der individuellen Orientierung basiert.
Die Tech-Perspektive: Was KI und UX-Design lernen können
Moderne Technologien spiegeln zunehmend westliches Denken wider. GPS-Apps, AR-Tools und sogar Robotik orientieren sich oft egozentrisch. Entwickler sehen jedoch Grenzen bei der Anpassung dieser Tools an den globalen Einsatz.
Die Einbindung geozentrischer Logik in die KI könnte zu Verbesserungen bei der autonomen Navigation führen, insbesondere in abgelegenem Gelände, wo feste Markierungen wichtiger sind als relative Hinweise.
UX-Designer überdenken außerdem die Richtungssprache in mehrsprachigen Apps, um intuitive Benutzeroberflächen zu gewährleisten.
Dieses kulturelle Bewusstsein ist nicht nur ethisch, sondern auch praktisch. Es erinnert uns daran, dass nicht alle Nutzer in Kategorien wie „links“ oder „rechts“ denken. Sie können diese Schnittstelle anhand einer detaillierten Analyse weiter untersuchen unter MIT Technology Review.
Was wir bei der Übersetzung verlieren
Ironischerweise gelingt es dem Englischen oft nicht, diese räumlichen Nuancen zu übersetzen. Wenn indigene Sprecher zu dominanten Sprachen wechseln, verlassen sie oft geozentrische Strukturen und verlieren damit nicht nur ihren Wortschatz, sondern auch Jahrhunderte alte kulturelle Weisheit.
Dieser Sprachverlust schwächt das ökologische Bewusstsein und die Erhaltung des kulturellen Erbes.
Darüber hinaus schränkt es die Palette der kognitiven Modelle ein, die der Menschheit zur Verfügung stehen. Bei der Förderung mehrsprachiger Bildung und der Bewahrung indigener Sprachen geht es nicht nur um Kultur – es geht darum, alternative Denkmodelle am Leben zu erhalten.
Abschließende Gedanken: Worte, die die Welt verändern
Das Fehlen einer Wort für „links“ oder „rechts“ ist kein Hinweis auf einen Mangel. Es weist auf eine andere Art von Intelligenz hin – eine, die die Welt nicht durch die Linse des Selbst sieht, sondern durch ihre unveränderliche Geographie.
Diese sprachlichen Muster stellen Annahmen in Frage, erweitern die kognitive Vielfalt und bereichern unser Verständnis der menschlichen Anpassungsfähigkeit.
Angesichts der fortschreitenden Globalisierung bietet die Würdigung dieser räumlichen Systeme mehr als nur Neugier. Sie bietet Einsicht, Demut und ist ein Aufruf, die Art und Weise zu bewahren, wie Sprache das Denken prägt.
Häufig gestellte Fragen
1. Verwenden alle Kulturen ohne „links“ und „rechts“ Himmelsrichtungen?
Nicht unbedingt. Manche verwenden topografische Angaben wie „flussaufwärts“ oder sogar heilige Richtungen, die auf Orientierungspunkten basieren.
2. Betrifft dies nur die Sprache?
Nein. Es beeinflusst die Wahrnehmung, das räumliche Gedächtnis, die Architektur, Rituale und sogar die Entwicklung von Kindern.
3. Verschwinden diese Sprachsysteme?
Leider ja. Durch die Dominanz globaler Sprachen sind viele traditionelle Raumsysteme bedroht.
4. Hat dies praktische Anwendungen außerhalb der Linguistik?
Auf jeden Fall. Künstliche Intelligenz, User Experience Design und sogar Umweltbildung können vom geozentrischen Denken profitieren.
